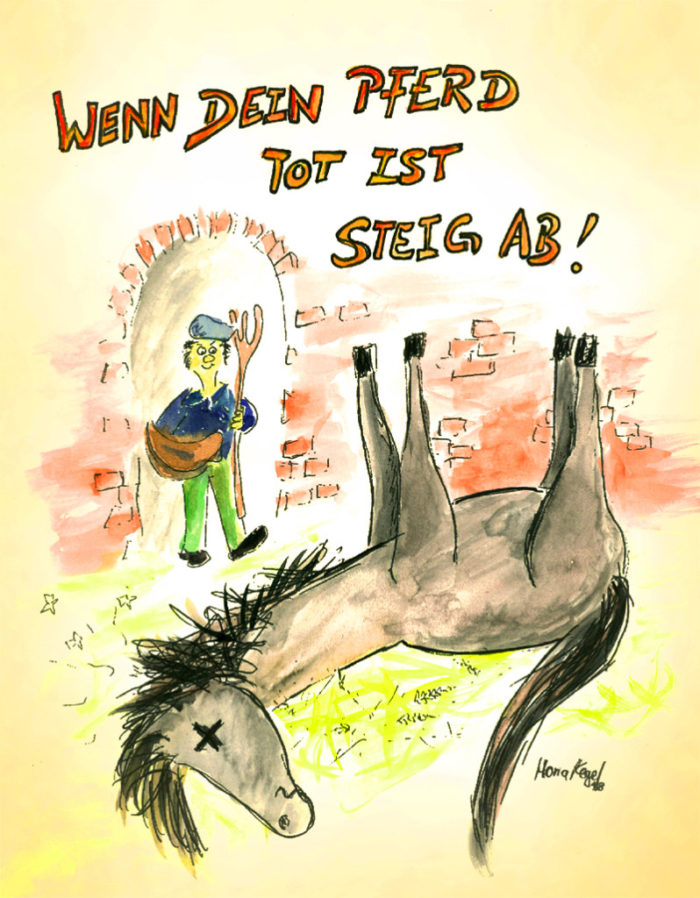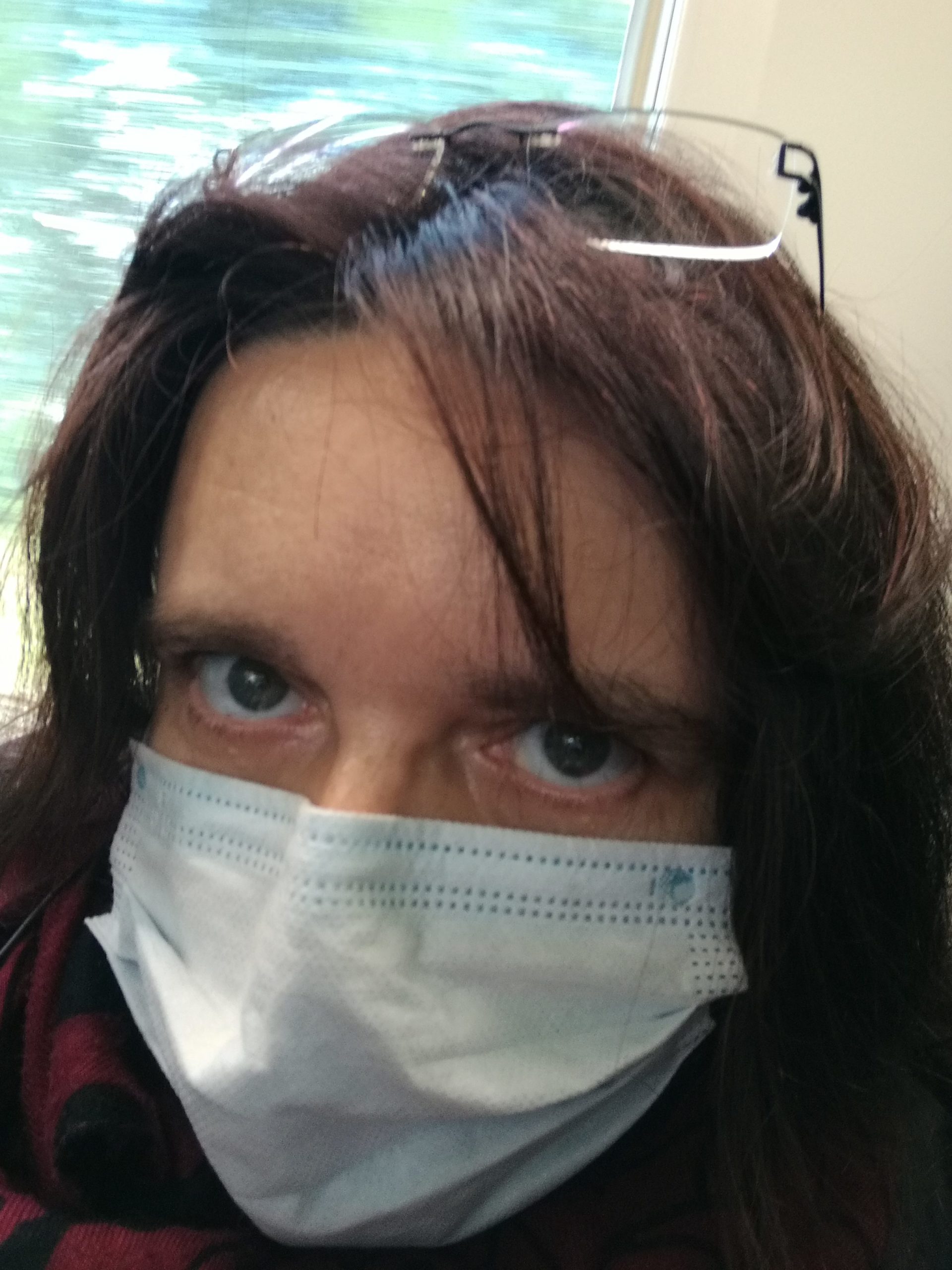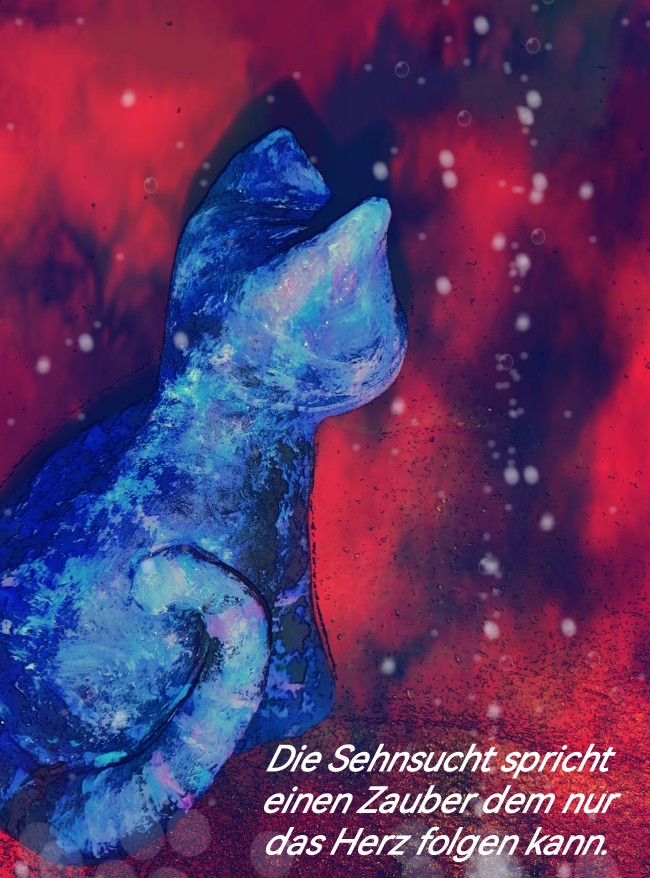Ich kann Mikado. Als Kind habe ich dieses Spiel sehr oft und gern gespielt. Es hat mir enorm viel Spaß gebracht, mit Achtsamkeit und Feingefühl die losen Stäbchen herauszufinden und sie geschickt herauszuziehen, ohne dass es wackelt.
Neulich habe ich darüber nachgedacht, warum so viele Menschen denken, dass man erstmal alles ausräumen und dann neu aufbauen muss. In vielen Fernsehsendungen wird dies so vorgespielt: Da ist das Haus oder die Wohnung, aus der die Familie für eine oder mehrere Wochen ausquartiert wird und dann macht ein Team alles schick. Danach zieht die vermeintlich glückliche Familie wieder ein. Da gehen Menschen zu einem Coach der erst einmal alles niederreißt und sie dann mit dem neuen Image angeblich geheilt entlässt… Stellen Sie sich doch einmal vor, wie das ist: Da kommt jemand, nimmt Ihnen alles weg und macht dann, was er oder sie für richtig hält mit und aus Ihnen. Dann stehen Sie da, in Ihrem neuen Ich-Kostüm, fühlen sich vermutlich leicht euphorisch und doch auch ziemlich fremd, voller bester Vorsätze, dass ab jetzt alles anders wird… Und dann, dann kommt der Alltag, die Menschen von „vorher“ sind auch „nachher noch da“ und zwar genau so, wie sie waren. Die Gegend ist die gleiche, das ganze Umfeld und auch all die alten Gewohnheiten und Handlungsmuster sind gleich… Das Einzige, was jetzt ziemlich bunt und fremd in allem herumsteht und nicht recht weiß, wie man dazu passen, wie man sich verhalten soll, ja, wer man eigentlich jetzt ist, das sind Sie.
Wenn Menschen sich Unterstützung suchen, dann denken sie manchmal, dass es so oder so ähnlich sein muss, dass man alles Schlechte ausmerzt, es durch Gutes ersetzt und dann wird alles gut und richtig. DAS IST EINE LÜGE! Und man muss auch nicht erst einmal alles heilen, was krank oder kaputt ist, um ein glückliches Leben führen zu können. Man kann auch eine Weile mit einem Gipsbein ganz gut klarkommen und nicht jede schiefe Nase muss gerichtet werden. Der oder die Einzige, der oder die entscheidet, wie weit es geht, sind Sie!
Veränderung ist ein kontinuierlicher Prozess, der im Kontakt und im Einklang mit Ihnen und Ihrem Umfeld stattfinden sollte.
Den Mythos von der kathartischen Veränderung halte ich nicht nur für unnötig und falsch, sondern auch für gemein-gefährlich!
1. Es gibt kein „fertig“
Die Ideen des vollkommen gesunden Menschen, der nach zig Jahren harter und anstrengender Therapie endlich geheilt entlassen wird und nunmehr endlich sein Leben in vollen Zügen genießen kann, ist eine, so finde ich, gruselige Vorstellung, die leider tatsächlich noch immer in vielen Köpfen schwebt. Bitte glauben Sie mir: Diese Idee ist ein Mythos und ein Irrtum. Man wird nie fertig! Die Welt ist nicht linear, sie ist vernetzt und zirculär. Richtig und falsch hängen vom Bezugspunkt ab, genau wie krank oder gesund und gut oder schlecht. Deswegen gibt es auch kein „fertig“. Ich schlage also vor, dass Sie lernen, mit den Widrigkeiten zu leben, sozusagen mit ihnen zu tanzen und sie so nach und nach in etwas zu verwandeln, was Ihnen weniger Leid oder Schmerz und mehr Nutzen oder Freude bereitet. Dabei unterstütze ich Sie selbstverständlich gern.
2. Wir leben in einem Mobile
Menschen und Dinge sind miteinander verbunden und nicht eines folgt nach dem anderen, sondern vieles geschieht gleichzeitig. Zwischen zwei Therapiesitzungen bleibt das Leben nicht stehen und deswegen ergibt es für mich auch keinen Sinn einem starren Plan zu folgen, den man sich nach einer Analyse überlegt hat. Sie sind mit den Menschen, Dingen und Ereignissen um Sie herum verbunden und ich bin es auch. Deswegen benutze ich gern das Bild eines Mobiles als Methapher. Wenn sich an einem Teil des Mobiles etwas ändert, dann wirkt sich dies auf das ganze Gefüge aus. Und selten gibt es nur eine Änderung zur Zeit. Also merke ich mir, was ich von Ihnen und mit Ihnen erfahren habe und wenn wir uns dann wieder begegnen, bin ich neugierig und offen für das, was dann sein wird. Es ist vielleicht so, als würde ich ab und an mit in Ihr Boot steigen und eine Stunde als Begleiterin mit Ihnen fahren. So wie man nie zweimal in den gleichen Fluss steigt, ist auch jede Begegnung mit einem Menschen einzigartig.
3. Die Würde des Menschen ist unantastbar
Weiter oben im Text habe ich geschrieben, dass es kein allgemeingültiges Richtig oder Falsch gibt, dass es meiner Meinung nach immer eines Bezugspunktes bedarf: Dieser Bezugspunkt sind Sie, um Ihrer Würde willen, um der Menschenwürde willen. Wie gesagt, ich steige als Begleiterin mit in Ihr Boot, ich helfe Ihnen gern, zu Ihrem Ziel zu gelangen, aber den Kurs, die Crew, die Ladung, die Ausstattung und die Geschwindigkeit bestimmen Sie. Weder weiß ich von mir aus, was bei Ihnen „nicht stimmt“, noch würde ich mir herausnehmen Ihnen zu sagen, wie Sie sein sollten. Ich höre aufmerksam zu, beobachte und nutze meine emphatischen Fähigkeiten, mein Wissen, meine Intuition und meine Erfahrung. Ich versuche Sie zu verstehen, versetze mich soweit ich kann in Ihre Welt, eben auf Ihr Boot. Von dort aus schauen wir dann gemeinsam, jedes Mal neu.
4. Leiden ist kein Selbstzweck
Es gibt einen weiteren Mythos, mit dem ich längst gebrochen habe, den der „großen Gefühle“. Natürlich kann es in einer Sitzung passieren, dass Menschen weinen, Verzweiflung oder ihre Wut zum Ausdruck bringen. Das ist vollkommen in Ordnung, es darf sein, muss nicht „weggemacht“ werden. Es kann ausgehalten, durchlebt und überwunden werden. Aber es ist explizit KEIN Selbstzweck und schon gar kein Ziel, dass unbedingt starke Gefühle zum Ausdruck gebracht werden müssen. Die Vorstellung, dass sich bei einem Gefühlsausbruch etwas löst, das mal was „raus“ muss und es dann gut, ist halte ich nur in einigen wenigen Fällen für zieldienlich. Manchmal ist es sogar schädlich, weil es die alten Wunden wieder aufreißt. Dennoch haben Menschen oft das Bedürfnis nach solchen Erlebnissen, danach geht es ihnen „irgendwie“ besser. Deswegen darf es sein. Wenn Sie dies aber nicht möchten und fürchten durch etwas „durch“ zu müssen, noch einmal tief in den Keller mit den Dämonen steigen zu müssen oder ähnliches, dann kann ich Sie beruhigen, darauf dürfen Sie auch verzichten. Manchmal ist es sogar ganz witzig, wenn man in den Keller steigt und dass Licht anmacht, trifft man auf lauter lustige Muppets mit komischen Hüten, die Karnevall feiern und nie vorhatten irgendwem Angst zu machen…
5. Humor hilft heilen
Humor hilft heilen, ebenso wie Nähe und Verbundenheit. Der Satz mit den Muppets aus dem letzten Abschnitt könnte den Eindruck erwecken, dass ich meine Kunden nicht ganz ernst nehme, aber weit gefehlt, das Gegenteil ist der Fall! Lachen befreit und es gäbe weder Satire noch Sarkasmus ohne die erleichternde Wirkung eines Lachens auf unerträglich Erscheinendes. Ein bisschen ist es, als würde man mit den Widrigkeiten tanzen. Wir nehmen den „Monstern“ die Macht dadurch, dass wir ihnen ins Gesicht lachen, wir tanzen mit dem Drachen und zähmen ihn dabei so lange, bis er uns aus der Hand frisst. Aber nicht jeder oder jede mag dies, ich lache gern mit Ihnen, aber niemals über Sie. Lassen Sie die Trolle ruhig trommeln, das können die gerne auch vor der Tür…
6. Wenn es leicht geht, dann machen wir es leicht
Bei mir müssen Sie sich niemals quälen! Es darf leicht sein, es sollte sogar leicht sein. Ich werde Ihnen keine Garantie dafür geben, dass ich immer einen Weg finde, aber ich finde sehr oft einen Weg und wir finden meistens einen Weg, der Sie näher an Ihr Ziel bringt. Frei nach dem Motto „Umwege erhöhen die Ortskenntnis“ ist es manchmal sehr wichtig den einen oder anderen Schlenker zu machen. Die Seele geht zu Fuß, ich glaube ja sogar, dass sie barfuß geht und man sie deswegen nicht so gern über’s Eis und über spitze Steine schicken sollte. Damit komme ich nun auch zu meinem letzten Punkt für diesen Text:
7. Nürnberger Trichter war und ist ein Folterinstrument!
Zu schnell, zu viel und zu lange ist nicht gut! Viel hilft leider überhaupt nicht viel. Aktionismus kostet nur Kraft und ist Zeitverschwendung. Manchmal kommen Menschen und möchten schnell gaaanz viel ändern und am Ende haben sie nichts geschafft außer sich selbst.
Inzwischen habe ich verstanden, dass es wichtig ist zu schauen – in Ruhe, nach dem längsten Hebel, dem am leichtesten herausziehbaren Stäbchen – zu schauen und dann in aller Ruhe an die Arbeit zu gehen. Und das ist einer der wenigen Punkte wo, ich manchmal ein ganz klein wenig sperrig werde. Ich weise Sie darauf hin, wenn ich das Gefühl habe, dass sie Schiff und Mannschaft überfordern. Ich versuche dennoch alles, dass Sie trotzdem noch einen Fisch fangen oder vorankommen und ich vertraue darauf, dass die Seele ihren Weg findet und sich herausucht, was sie brauchen kann. Was sie auf wundersame Weise immer tut.
Ich selbst versuche allerdings, nicht mehr aufzutischen als nötig ist. Sollte ich dennoch einmal ein bisschen zu ehrgeizig daherkommen, dann erinnern Sie mich unbedingt daran, dass der Nürnberger Trichter ein Folterinstrument ist.
Und was hat das Ganze jetzt mit Mikado zu tun?
Mikado spielen bedeutet, dass man in aller Ruhe einen Stab nach dem anderen heraus zieht, dass man genau hinsieht, wie der Stapel jetzt liegt. Denn jedes Mal, wenn man wieder dran ist, dann hat es ja vorher beim Mitspieler oder der Mitspielerin gewackelt. Vielleicht liegen die Stäbchen jetzt also anders. Mikado spielen bedeutet, das man immer nur einen Stab zur Zeit heraus zieht und zwar so, dass der Rest des Haufens liegen bleibt…
Jedem passiert es, dass es mal wackelt, auch mir. So ist das Leben und das ist gut so.
Man ist nie fertig – es gibt immer einen Weg – Humor, Vertrauen, Verbundenheit, Tanzen und die Liebe zum Leben helfen!
Lernen Sie Mikado, es lohnt sich.