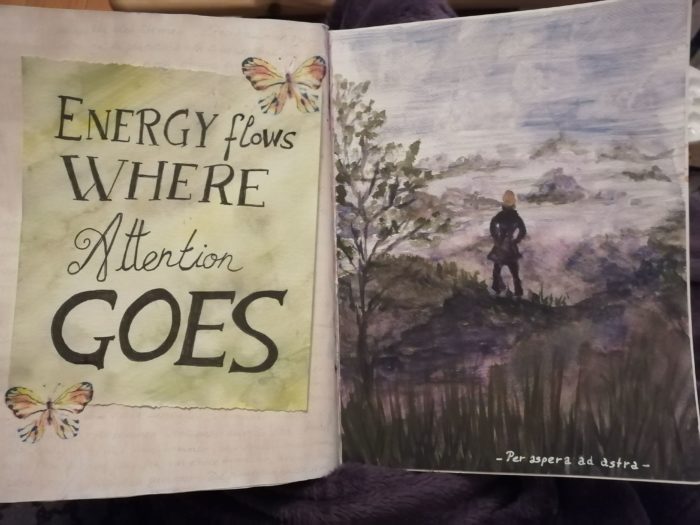Man sagt, dass Sucht immer auch mit Sehnsucht und mit Suche korreliert. Wir sehnen uns nach etwas, wir suchen danach und manchmal ist die Bedürftigkeit so stark, dass das Loch in der Seele zum schwarzen Loch wird. Schwarze Löcher haben eine sehr starke Anziehungskraft. Durch Projektion und Überstrahlung erzeugen wir schwarze Löcher in unserer Seele. Dies passiert dann, wenn die Not, die Bedürftigkeit so bedeutend wird, dass ihre Erfüllung zur Überlebensfrage wird.
Wenn ein Kind erlebt, dass seine Bedürfnisse nicht wahrgenommen oder gar abgelehnt werden, wenn es erfährt, dass es wählen muss zwischen Bedürfnisbefriedigung oder Zugehörigkeit, also zwischen Autonomie oder Sicherheit, dann bildet es die Veranlagung zum Suchtcharakter. Dies ist in unserer Gesellschaft so häufig, dass es uns normal erscheint. Wir kokettieren sogar damit nach etwas „süchtig“ zu sein und daher nicht „anders zu können“.

Anne Wilson Shaef hat sich in ihrem Buch „Im Zeitalter der Sucht“ näher mit dieser gesellschaftlichen „Normalität“ beschäftigt. Sie beleuchtet in ihren Büchern alltägliche Pänomene im Hinblick auf Sucht, Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit. Es ist unter anderem deren Lektüre, die mich zu meinem hier beschriebenen Meinungsbild geleitet hat.
Sucht ist eine Erwartungserinnerung. Wir erinnern uns an die Erwartung (von Erleichterung), nicht an die Enttäuschung. Die Entäuschung nämlich, dass diese Erwartung in der Regel unerfüllt bleibt. So versuchen wir immer „mehr desselben“. Wir drücken immer engagierter, um eine Tür zu öffnen, auf der eigentlich „ziehen“ steht. Die Verzweiflung und die Not wachsen, der Abstand und die Ressourcen schwinden, wir sitzen fest. Zu schwach um uns zu befreien, weil wir unsere Kraft an die kathartische Idee der endlichen Bedürfnisbefriedigung verschwendet haben. Das kann tödlich enden!
Wir hängen an der Nadel, die uns mit Gift versorgt und eben dieses Gift schwächt uns immer weiter, sodass wir am Ende quasi verhungern. Es ist, als würden wir eine leere Schachtel immer wieder öffnen, um etwas Nahrhaftes zu erhalten.
Menschen haben im Wesentlichen zwei Grundbedürfnisse: Bindung und Autonomie bzw. Sicherheit und Freiheit. Dürfen diese gleichberechtigt bestehen, kann Zufriedenheit, Lebendigkeit und Glück gelingen. Wenn Autonomie, also Selbstwirksamkeitserleben und Zugehörigkeit in einen Konflikt gebracht werden, einander also vermeintlich auschließen, dann kommt es zu einem gnadenlosen innermenschlichen Totentanz.
Dieses Mem ist in unserer Gesellschaft leider weit verbreitet, eine Art transgenerationaler Erbfluch aus militärischen Zeiten. Man propagiert Härte, Genügsamkeit, Disziplin, Klarheit und Fleiß, man verachtet Transzendenz, Zärtlichkeit, Mitgefühl und Sensibilität, das ist mindestens deutsche Tradition. So glaubte man, Kriege gewinnen oder wenigstens überstehen zu können. Das mag sogar stimmen, aber Frieden oder Zufriedenheit schaffen, dass kann man nur mit unerschrockener Herzlichkeit, durch vertrauensvolle Liebe und den Mut zur Verbundenheit.
So bleiben wir, uns gegenseitig und in unserem tiefen Glauben selbst verstärkend, im Netz einiger fataler Irrtümer gefangen. Dieses Netz zu zerschneiden, benötigt den Mut eines Narren und das treue Herz seines Hundes.
In Anlehnung an Kafkas Text „Auf der Galerie“ möchte ich sagen: Möge jemand das Halt ausrufen, möge jemand diesen Zirkus beenden…
Möge die schweigende, leidende Menge eines Tages erkennen, dass sie in Liebe und Sehnsucht verbunden ist – möge die Stille zu einem dröhnenden Sturm heranwachsen, der einem Taifun gleicht. Einem Wirbelsturm, der sich gleichmütig einen Weg durch die Stadt der Lügengebäude bahnt und alles zum Wiederaufbau vorbereitet, was uns gefangen hält.
In diesem Sinne…
Your choice, take it, take care…